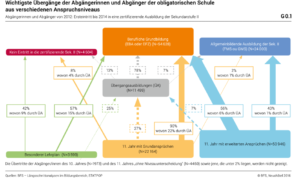«Wir bauen eine Brücke von der Sek zu den Mittelschulen und zur Lehre mit Berufsmatura»
Das Aargauer Förderprogramm zur Chancengerechtigkeit durch Arbeit an der Lernlaufbahn «Chagall» gilt als richtungsweisend und vorbildlich. Rolf Häner, Rektor der Berufsfachschule Baden, erklärt warum.
Was sind die Gründe für die BBB und für Sie selbst, sich für Chancengerechtigkeit einzusetzen?
Ein wichtiger Grund ist sicher unsere Gesamtstrategie. Es geht ja sehr vieles Richtung personalisiertes Lernen. Wir sehen heute in den Lernenden Individuen mit verschieden grossen Rucksäcken. Das mündet in chancengerechtes Lernen: Wir wollen allen Lernenden gerecht werden, sie individuell fördern und ihnen zielgerichtet eine Perspektive aufzeigen, das ist unser Grundanspruch.
Engagement für Chancengerechtigkeit beginnt also mit der Anerkennung von Diversität?
Ja, es kommen höchst unterschiedliche junge Persönlichkeiten zu uns. Ein konkretes Beispiel ist Bring Your Own Device (BYOD). Ob Attest-Lernende oder Berufsmaturanden – alle haben ein eigenes Gerät. Nun haben wir aber bemerkt, dass einzelne Lernende mit Geräten quasi frisch vom Laden und sehr wenigen IT-Kompetenzen zu uns kommen. Darum machen wir ab diesem Jahr in der letzten Sommerferienwoche einen Einführungstag, bei dem es nur darum geht, die Geräte in Gang zu bringen. Dieses kleine Beispiel ist für mich Ausdruck von Chancengerechtigkeit: Dass wir vorhandene Bedürfnisse ernst nehmen.
Diese wurzeln aber nicht zuletzt in der Herkunft der Jugendlichen.
Da sieht man an Elternabenden: Die BM-Klassen sind sehr gut besucht von Eltern, bei den Attest-Klassen kommt teilweise vielleicht der Berufsbildner oder die Berufsbildnerin des Lehrbetriebes. Der sozioökonomische Hintergrund ist massgeblich für die Schullaufbahn von Jugendlichen, dieses Bewusstsein sollte noch mehr bei vielen Stakeholdern im Bildungssystem einfliessen.
Zum Beispiel im Kanton Zürich, dessen Regierungsrat ein Postulat zur Förderung der Chancengerechtigkeit ablehnt mit der Begründung, man habe bereits genug getan, mehr sei nicht nörig.
Das finde ich schade. In Zürich gibt es seit gut zehn Jahren das erfolgreiche Förderprogramm ChagALL. Ein Programm, welches das vorhin erwähnte Bewusstsein schärft und für zahlreiche junge Leute ein für Ihre Bildungskarriere wichtiges Sprungbrett war.
So wie im Kanton Aargau.
Ja, die Kanti Baden hat die Chance erkannt, dass man mit dem Engagement für Chancengerechtigkeit ein Zeichen setzen kann. Unterstützt vom Regierungsrat und vom Bildungsamt haben wir es gemeinsam geschafft, dass Sekundar-, Berufsfach- und Kantonsschulen im Projekt Chagall AG zusammenarbeiten. Wir zeigen: Chancengerechtigkeit für Jugendliche ist uns wichtig.
Nicht wenige Leute bezeichnen das Aargauer Engagement als vorbildlich und richtungsweisend. Was ist das Spezielle daran?
Das Bewusstsein, gemeinsam etwas tun zu müssen. Deshalb ist Chagall AG als Initiative zwischen den Bezirks- und Sekundarschulen Spreitenbach, Wettingen und Baden sowie der Berufsfachschule und der Kantonsschule Baden konzipiert. Es ist kein aussschliesslich gymnasiales Förderprogramm, viele Absolvent:innen machen ein KV mit Berufsmatura oder eine technische Lehre mit Berufsmatura. Wir bauen eine Brücke von der Sek zu den Mittelschulen und zur Lehre mit Berufsmatura.
Welchen Nutzen ziehen die Schulleitungen aus dieser Kooperation?
Vor allem punkto Vernetzung, das ist mit sehr wichtig. Wir entwickeln Verständnis füreinander, es findet ein informeller, stufenübergreifender Austausch, der extrem befruchtend ist. Wenn ich mit meinen Kollegen von der Kanti Baden oder von der Schule Spreitenbach über das Projekt diskutiere, lerne ich stets etwas dazu. Das sagen übrigens auch die Lehrpersonen, die im Rahmen von Chagall AG unterrichten.
Wie eigentlich entstand diese Zusammenarbeit der verschiedenen Schulen?
Es war ein Bottom-up-Projekt. Am Anfang stand die Initiative von Daniel Franz und Roger Stiel, die das Bedürfnis nach gerechten Berufschancen für Jugendliche erkannten. Sie bauten Chagall AG auf und trieben es voran. Dann kam die Berufsbildung hinzu. Als Daniel Franz und ich uns zum ersten Mal trafen, waren wir beide überzeugt, dass nicht jeder in die Kanti muss, begabte Jugendliche können auch einen Beruf erlernen und die Berufsmatura machen. Das Verständnis, dass man zusammenarbeitet, ist im Aargau stark ausgeprägt.
Wer finanziert eigentlich Chagall AG?
Der Kanton über den Swisslos-Fonds, aus Mitteln des breit abgestützten Fonds «ChagALL Initiative», aus den Budgets der beteiligten Schulen und aus hohen Eigenleistungen der Schulleitungen und der Lehrpersonen aus den beteiligten Schulen. Ausserdem beabsichtigt der Regierungsrat des Kanton Aargau, unser Projekt in den kantonalen Finanzierungsplan aufzunehmen.
Gab oder gibt es eigentlich nie Skepsis, Widerstand gar, zum Beispiel aus der Politik?
Nicht dass ich wüsste, im Gegenteil, das Bedürfnis nach chancengerechter Bildung ist im Kanton Aargau anerkannt.
Die PH FHNW evaluiert Chagall AG seit Beginn, jetzt liegt ein Zwischenbericht vor. Welches sind die wichtigsten Ergebnisse?
Das Programm ist eine Erfolgsgeschichte. Es hat sich auf hohem Niveau etabliert und wird von einer konstanten Anzahl Schüler:innen nachgefragt. Chagall AG ist auf bestem Weg, so dass es demnächst auch in Wohlen und Aarau angeboten wird.
Blicken wir abschliessend in die Glaskugel aufs Jahr 2032, wie stehts um die Chancengerechtigkeit im Kanton Aargau, in der Schweiz?
Ich sehe nur positive Entwicklungen. Das Bewusstsein ist vorhanden, man muss ihm nur etwas Zeit geben. Es wächst eine neue Generation von Schulleitungen heran, die gewillt ist, noch vernetzter unterwegs zu sein. Dank des kompetenz- und handlungsorientierten Unterrichts schaut man nicht mehr darauf, was Schüler:innen für Noten mitbringen, sondern was sie im Rucksack haben. Man wird mehr auf die individuellen Talente, Begabungen und Potentiale eingehen – das alles eröffnet der Förderung von Chancengerechtigkeit vielversprechende Perspektiven.